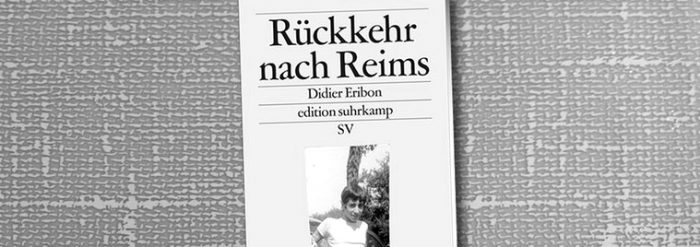Als ich jüngst mit linken Freunden und Bekannten ins Gespräch über die Wahl Donald Trumps kam, wurde mir schlagartig klar, in welch desolater Situation wir uns befinden. Unabhängig voneinander äußerte sich bei vielen der letzte Schluss, es helfe wohl nur noch ein Attentat. Nun hatte man sich also der Regression schlussendlich anverwandelt, die man zuvor noch in selbstgewisser Distanz als Verrohung und Barbarisierung aburteilte. Es ist weniger die konkrete Forderung – die nicht ernst und niemals programmatisch gemeint sein dürfte –, vielmehr das unterschwellige Zugeständnis an jenen hilflosen Zynismus, der zutiefst beunruhigend ist. Die Hilflosigkeit kumuliert dort, wo die Welt, oder zumindest ein Verständnis von ihr, sich der Kontrolle vollends entzieht. Mit Trump tritt das Absehbare ein, das doch bis zuletzt als unmöglich galt. Der Moment also, in dem die realistische Analyse zur naiv idealistischen Hoffnung degradiert wurde und man sich auf derselben Stufe der intellektuellen Wehrlosigkeit gegen den Zusammenhang befindet wie die Verschwörungstheorie oder der Pegida-Aufmarsch.
Lange ließ sich diese Entwicklung schon als ein Prozess intellektueller Enteignung beobachten: Der Milleniumshype des Altermondialismus wurde mit dem war on terror herausgefordert und verklang anschließend in der Depression der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Das letzte Aufbäumen in den Hoffnungen auf die zahlreichen Besetzungen von Occupy bis zum Tahrir-Platz hatte dem Regress schon nicht mehr viel entgegenzusetzen, und dort, wo man es wie in Griechenland oder Spanien mittels Institutionalisierung in Parteien versuchte, wurde schnell klar, dass das vorprogrammierte Scheitern der Linken nur der folgerichtige nächste Schritt derselben Regression war (nicht umsonst freuten sich die Faschisten in Griechenland über Syrizas Wahlsieg, man ließ sie machen, da man kalkulierte, in ihrem Schatten als die einzige Alternative aufsteigen zu können). Vom Gesichtspunkt einer anders möglichen Welt engte sich das Blickfeld zusehends ein auf den wieder notwendigen antifaschistischen Verteidigungskampf gegen den braunen Mob. Die lokalen Antifastrukturen hatten gerade ihre Selbstfindung in Fusionen und Theoriearbeit vorangetrieben, die Theorielinke wiederum war für keinen Straßenkampf zu gebrauchen. Mittlerweile stehen die Zeichen vielerorts auf Verteidigung der emanzipatorischen Basics, während der reaktionäre backlash schon längst Parlamentswahlen anvisiert. Genau an diesem Punkt greift die Verlusterfahrung, in der das Nachdenken über die befreite Gesellschaft zum Anachronismus degradiert wurde.
Dies als Enteignung zu benennen sollte keinesfalls den Blick darauf verstellen, dass es sich mitnichten um einen äußerlichen Prozess handelt. Linke Theorie und Praxis hat sich ihre Schwäche aus sich selbst herbeigeführt und den ursprünglich reaktionären Vorwurf, ein Blick auf das große Ganze sei immer schon latent totalitär, zum tiefsten Selbstverständnis internalisiert. Die Waffen der Kritik wurden als Dekonstruktion und Hegemonietheorie neu konzipiert, die Performativität des Wissens, die Effekte der Macht, die Subjektpositionen als Ziel anvisiert. Unterschwellig treibt dies den, wie Bini Adamczak sagen würde, Verlust des revolutionären Verlusts voran. Eine verdoppelte Depression, die selbst in der von links so gern angeeigneten Popkultur offener zutage tritt als in der Theorie: in diffusem Leiden im kalten Hedonismus der Technoszenen, intellektuellem Vakuum des Dub á la Burial oder der utopistischen Absage Radioheads (Don’t get any big ideas/they’re not gonna happen). Umso zynischer, dass nun von Linken selbst beklagt wird, es fehle an linken Visionen. Bevor naiv der Utopismus beschworen werden sollte, fehlt es zuerst an linker Erkenntnisfähigkeit.
Das ist nicht leicht zu verdauen, denn es steht zunächst noch vor jeder Möglichkeit einer direkten Umsetzung und damit der Möglichkeit, dass es akut besser werden kann. Je tiefer die Verzweiflung allerdings sitzt, desto schwerer ist es, sich mit Grundsätzlichem und im wahrsten Sinne Unproduktivem abzugeben. Das marxistische Credo ‚Was tun?‘ macht überhaupt erst Sinn vor dem Hintergrund der Erkenntnis, mit was man es eigentlich zu tun hat, denn es ging niemals darum, nur irgendetwas zu tun, sondern das richtige zu tun.
Interessanterweise tritt in dieser Konstellation ein ungewöhnlicher Protagonist auf, der, ohne diese Problemdiagnose zu explizieren, eine bemerkenswerte Andeutung macht, mit dieser umzugehen: Didier Eribon, dessen jüngstes, halb-autobiografisches Werk eine doppeldeutige Rückkehr vollzieht, in der Rückbesinnung auf die Ursprünge seiner eigenen Analysen und damit auf einen verschütteten Ausgangspunkt der Genese zeitgenössischer Theorie. Seit der deutschen Übersetzung seiner Rückkehr nach Reims vergeht kaum eine größere Podiumsdiskussion zur Zukunft Europas, dem Aufstieg der neuen Rechten oder allgemein zur Linken ohne sein Beisein. Das Feuilleton ist voll kritischer Würdigung seiner Analysen und bestechenden Selbstkritik, an der sich zugleich das Schicksal der Linken abhandeln ließe. Ohne die Begeisterung vollends zurückweisen zu wollen, bedarf es doch einer Klarstellung in Bezug auf Eribon: Er ist trotz allem mehr Symptom denn Lösung des desolaten Zustands der gesellschaftlichen Linken. Nichtsdestotrotz sollte sein Vorschlag einer Rückkehr ernst genommen werden.
Eribon kehrt zur Beerdigung seines Vaters in seinen Heimatort zurück, den er als 21-jähriger Wahlintellektueller in Richtung verheißungsvolles Paris verließ. Mit seiner Rückkehr dorthin kehrt für ihn zugleich etwas in sein Bewusstsein zurück, das er in den Identitätskämpfen eines jungen Schwulen im akademischen Milieu fast verschüttet geglaubt hatte und das ihm nun umso deutlicher wieder vor Augen tritt: seine Klassenherkunft. Die Konfrontation mit dem Herkunftsmilieu führt zum Bekenntnis eines geläuterten Foucauldianers, dessen gesamtes akademisches Werk sich den subjektiven Herrschaftsformen widmete, weil es von der individuellen Betroffenheit qua Zugehörigkeit zu einer sexuellen Minorität ausging. Eribon, wie Foucault, wollte sich selbst verstehen und dabei die schmerzhafte Welt hinter sich lassen. Dann ist sie ihm wieder gegenwärtig und er muss sich selbst darüber wundern, warum er nie auf den Gedanken kam, dass all den Mechanismen der Macht, die er zu ergründen suchte, jene Konstellation sozialer Herrschaft zugrunde liegt, die er nun überall vorzufinden glaubt, die ihm so offen zu liegen scheint, dass der Rekurs auf den Klassenbegriff hier und da zur Übersprungshandlung wird.
An seiner eigenen Biografie spielt er diese neugefundene Analysedimension durch: Der Klassenstolz der Eltern, die sich von einem englischen Gedichtvortrag des jungen Gymnasiasten beleidigt fühlen, dessen pseudoelitäre Bildung sie sich vom Munde absparen; die lebensweltliche Funktion des Klassenbewusstseins, das kein politisches Bewusstsein, sondern Selbstreferentialität der sozialen Realität ist; die systematische Unterdrückung der Arbeiter im Bildungs‑, Arbeits- und Freizeitsystem, die jede scheinbar freie Wahl zutiefst determiniert. Und immer wieder seine eigene verzweifelte Bemühung, sich über die Klassengrenze hinweg in die Bürgerlichkeit zu retten und deren liberalem Freiheitsversprechen, das es ihm ermöglicht, brennender Marxist zu sein und zugleich die Arbeiter für ihren Proletarismus zu verachten. Sie sind anders links als er selbst, das spürt er spätestens als seine Eltern anfangen rechts zu wählen. Von vielen Seiten wird seine Analyse der Regression der Arbeiterschaft, dem Scheitern der Parteilinken, die den Vormarsch des Front National ebnet, hervorgehoben. Die Klarheit, mit der er die Zersetzung der kollektiven Identifikationsbasis als Klasse, die zur Identifikation als Nationalsubjekt wieder Halt findet, ist treffend, aber nicht schlagend. Sie ist nicht die eigentliche Stärke der Eribonschen Selbstreflexion, ganz im Gegenteil, an genau diesem Punkt wird klar, wie ihm die fehlende Konsequenz seiner eigenen Explorationen doch zum Fallstrick wird, nur die schon gängigen Allgemeinplätze zu wiederholen.
Eribon erringt eine vage Einsicht in das, was einmal marxistisch als gesellschaftliche Determination begriffen wurde, der Ausgangspunkt der Ideologiekritik. Er selbst stand in seiner Biografie noch an der Schwelle, an der diese Begrifflichkeiten zugunsten einer Diskursmetaphorik auf den Barrikaden des Mai ’68 überwunden wurde, es muss ihm wie ein Echo aus der Vergangenheit vorkommen, das er wiederum nicht aufnehmen kann. Seine Rückkehr an den Ausgangspunkt aller persönlicher Disposition soll schließlich kein Rückschritt sein. Deshalb bemüht er eine Kritik an Bourdieu um nicht wieder „bei der mystischen Beschwörungsformel vom ‚Klassenkampf‘ zu landen“ (144), aber stattdessen mystifizierend die „grundlegendsten Funktionsweisen und alltäglichsten Mechanismen der Gesellschaft als einen ‚Krieg‘ des Bürgertums und der herrschenden Klassen, eines unsichtbaren (oder viel zu sichtbaren) Feindes gegen die populären Klassen zu beschreiben“ (111). Was das Feuilleton als Stärke feierte, seine Analyse der Regression, ist dort die eigentliche Schwäche, wo sich Eribon nicht zur Erkenntnis des Zusammenhangs hinreißen lassen will.
Die Analyse bleibt am entscheidenden Punkt damit Koketterie mit dem Klassenbegriff und seinen strengen theoretischen Implikationen. Eribon kommt am Ende dann doch nur dort an, wo er losgegangen war, in einem quasi-hegemonietheoretischen Setting, in dem die Linke sich aufmachen müsse, um in Konkurrenz zur rechten Weltsicht eine bessere Deutung anzubieten, die die regressive Gesellschaft von ihren Irrationalitäten weglocken könne. Es bedeutet nichts anderes als jener Ruf nach einer linken Vision, der eines der deutlichsten Symptome der Hilflosigkeit ist. Eine Rückkehr also zu einmal mehr dem postmarxistischen Allgemeinplatz, die Erkenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse sei eine Überzeugungsfrage. Es verkennt dabei, dass die eigentliche ‚Konkurrenz‘ zum rechten Irrationalismus entlang der Linie von Erkenntnis und Verblendung verläuft, nicht entlang des besseren oder schlechteren Populismus. Trotzdem ist der Umweg, den Eribon beschreibt eine Errungenschaft, nicht unbedingt im Kampf gegen die Irrationalität auf der Strasse und der sogenannten Lebenswelt, aber gegen die theoretische Irrationalität, die der Frage der politischen Praxis (Was tun? – die immer schon Erkenntnisziel materialistischer Theoriebildung war) vorausgeht.
Denn wenn es anfangs hieß, das Problem der Linken sei ihre mangelnde Erkenntnisfähigkeit, so schlägt sich das genau dort nieder, wo die Verschwörungstheorie oder die vereinfachten Deutungsmuster rechter Ideologien nur mit dem Hinweis pariert werden können, jeder Anspruch auf Objektivität sei schon Verschwörungstheorie und Ideologie. In anderer Spielart bleibt dies auch Eribons Prämisse, die er gleichzeitig mit seiner Rückkehr nach Reims implizit herausfordert. Die von links als emanzipatorisch vorgebrachte programmatische Destabilisierung jeder Erkenntnis ist keine Waffe gegen den Irrationalismus, eher dessen Erfüllungsgehilfe. In diesem desolaten Zustand erweist sich der Impuls der Rückkehr zu den Begriffen der sozialen Zusammenhänge tatsächlich als fortschrittlicher denn die Pointe seiner Ankunft in der Wiederholung der symptomatischen Appelle. Ein Impuls, mit dem fortzuschreiten ein Gewinn wäre.
von Alex Struwe