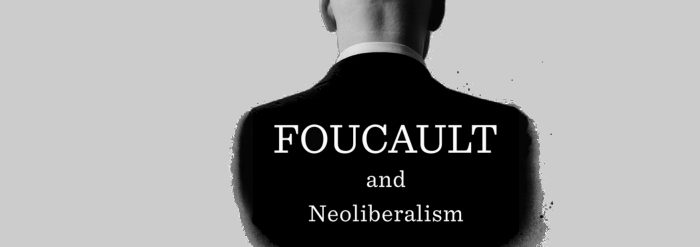Michel Foucaults sozialwissenschaftlicher Einfluss ist immens und unbestritten, so sehr, dass dahinter schnell verschwindet, welchen Bärendienst sein Wirken einer kritischen Sozialtheorie eigentlich aufgebürdet hat. Viele Aspekte seines Denkens haben sich zu einer Art theoretischem Horizont verstetigt, was es umso schwerer und zugleich notwendiger macht, sie herauszufordern.
Eine solche Herausforderung will auch der Sammelband zu Foucaults Verhältnis zum Neoliberalismus darstellen. Dieser erschien zunächst 2014 auf Französisch und löste, verlängert über ein Interview im Jacobin Magazin, eine Debatte unter leidenschaftlichen Foucaultianern aus, jedoch eher auf dem Niveau eines relativ banalen Schlagabtauschs. Denn es ist banal, Foucault lediglich als neoliberalen Apologeten enttarnen zu wollen, so wie es banal ist, diesen Vorwurf mit dem Verweis auf die Überkomplexität seines Werkes zu entkräften. Wichtiger als eine polemische Denunziation Foucaults ist die Analyse seiner Symptomatik, inwiefern also die Spezifik seiner Theoriebildung, deren Inkonsistenzen sich den Autoren zufolge an seinem Verhältnis zum Neoliberalismus erarbeiten ließen, über seine intellektuelle Biographie hinausgeht und Aufschluss über die gesellschaftliche Entwicklung gibt. So gelesen, wie Daniel Zamora in der kurzen Einleitung festhält, drückt Foucaults späte Hinwendung zu liberalen Ideen und deren Radikalisierungen eher eine Generationenerfahrung nach 1968, deren Desillusionierung vom Marxismus und eine gescheiterte Suche nach progressiven Alternativen aus (3).
Das diffuse Schlagwort Neoliberalismus fungiert daher eher als Klammer verschiedener Eckpunkte, die sich in Foucaults Werk verdichten. Da ist zuerst Foucaults Nähe zu den Neuen Philosophen, die Michael Scott Christoffersen herausarbeitet. Foucaults offene Bewunderung für André Glucksmanns Abrechnung mit dem Marxismus und seinen Meisterdenkern – wie sie in der Buchbesprechung The Great Rage of Facts zum Ausdruck kommt, die in Übersetzung ebenfalls im Band vorliegt – ergebe sich dabei aus einer seltsamen politischen Allianz. So gebe es zwar reale Widersprüche in deren theoretischen Konzepten (11), dass Glucksmann Foucault als große Inspiration seiner Thesen der notwendigen Kulmination aufklärerischer Emanzipation im Gulag darstellen kann, liegt demnach vor allem daran, dass dieser in dieselbe politische Kerbe schlägt, denn „Foucault was not less violently anti-communist than Glucksmann“ (16). Foucaults praktischer Antikommunismus korreliert mit einem theoretischen Antimarxismus, der Abwendung von jeder vermeintlich totalitären Theorie, also auch der Ideologiekritik. Aus dieser Haltung ergibt sich auch Foucaults „anarchistic bias“ (18) gegen alle staatlichen Institutionen, als gewissermaßen progressive Wendung der bürgerlichen Kritik des Marxismus.
Eine solche Disposition erlaube die Annäherung an regressiven Konservatismus wie den Glucksmanns ebenso wie an liberale Freiheitsideen. Michael C. Behrent arbeitet diesen Zusammenhang heraus, indem er Foucaults Faszination mit dem Marktliberalismus aus dessen Misstrauen gegen den Staat herleitet (29). Innerhalb der ökonomischen Krisensituation 1973 in Frankreich sowie der politischen Krise einer orientierungslosen Linken, wurden so die liberalen Konzepte zur Selbstbeschränkung staatlicher Herrschaft auch von Links attraktiv. Der Sozialismus der Second Left um beispielsweise Rosanvallon griff dies auf und wurde auch zum Bezugspunkt für Foucault (36), der jedoch die anthropologischen Grundlagen strikt ablehnte. Aus der Kritik eines Anthropomorphismus der Macht entspringt Foucaults theoretischer Antihumanismus, der ihn in die Nähe das ökonomischen Liberalismus brachte, von der aus sich auch sein Anarchismus und Antimarxismus zum theoretischen Schritt von der Ideologie zur Gouvernementalität verdichten ließ (54). An diesen Kongruenzen zeige sich nicht zuletzt „Foucault’s true significance in the deeper historical shifts to which his thought testifies“ (55).
Eine dieser historischen Entwicklungen ist die scheinbare Erosion des Proletariats im Nachkriegsfrankreich, die die linke Intelligenz umtreibt und auf die Foucault mit einer theoretischen Umorientierung auf verschiedenste Minoritäten und deren gesellschaftlichen Ausschluss antwortet. Wie Daniel Zamora in seinem Beitrag beschreibt, sei diese Verschiebung aber mit einem programmatischen Wechsel von der Makro- auf die Mikroebene verbunden: „the main question was to understand how part of the population was excluded, rather than how the majority was exploited“ (67). Foucaults Abkehr von einer Kritik der Produktionsverhältnisse, und damit einer Totalität der Gesellschaft, führe zu einer Perspektive auf lediglich die Umverteilung von Macht. Dies sei einerseits die Grundlage seiner Kritik an Regulation und dem Wohlfahrtsstaat, die ihn mit dem Neoliberalismus verbinde, andererseits das theoretische Pendent zu den Identitätspolitiken der Neuen Sozialen Bewegungen.
Auch darin beschreibt sich die Foucaultsche Ambivalenz, die ihn zwischen reaktionärer Ideologie und emanzipatorischer Suchbewegung scheinbar ungreifbar macht. Wie Mitchell Dean aus der Perspektive eines enttäuschten Foucaultianers feststellt, liege so auch Foucaults Faszination für den Amerikanischen Neoliberalismus der Chicago School an dessen Potential für eine nicht moralistische und nicht juridische Theorie des Staates, als progressive Perspektive (90). In diesem Sinne sei der Neoliberalismus theoretisches Vorbild für die Verwirklichung einer nicht subjektivierenden Macht und „by not doing so, it opens up the space for tolerating minority individuals and practices and optimizing systems of differences“ (100). Symptomatisch sei hierbei also gerade die vermeintlich progressive Aneignung liberalistischer Ideen, welche erst vor dem Hintergrund der konsequenten Abkehr vom Marxismus möglich werde, als „return to the tradition of a ‚libertarian Left‘ in opposition to the Left of the party machinery“ (108).
Diese Bewegung aber, so sehr sie sich auch den Anstrich einer progressiven Linken verleiht, ist eine grundlegend idealistische, wenn nicht gar ideologische. Das macht Jean-Loup Amselle mit seiner These deutlich, Foucault treibe eine ‚Spiritualisierung der Theorie‘ auf die Spitze. Gegen die Tradition der Aufklärung, die westliche Philosophie etc. bringe er eine programmatische Destabilisierung der Theorie in Stellung und „uses every means necessary, avidly mobilizing all forms of knowledge that can call into question the ensemble of totalizing interpretations of history and society“ (163). Die idealistische Grundlegung einer Theorie der Mikronarrative und ihrer korrespondierenden Politik der subjektiven Widerständigkeit entspricht dabei genau jener Diskreditierung des Marxismus, also historischen Materialismus, dessen Existenz erst die Trennung zwischen Idealismus und Materialismus mithin zwischen Ideologie und Erkenntnis bezeugte.
Die konkreten Konsequenzen der Aufgabe dieser Perspektive zugunsten idealistischer Theoriebildung beleuchten sowohl Loïc Wacquant in seinem Vorschlag zur Korrektur der Strukturblindheit Foucaults mit Bourdieus Feldbegriff (124), wie auch, wesentlich umfassender, Jan Rehmann. Dieser stellt Foucaults Forschungsprogramm zur Gouvernementalität der kritischen Ideologietheorie gegenüber und arbeitet so die systematischen Schwachpunkte nicht nur von Foucaults Konzepten selbst, sondern vor allem den daran unkritisch anschließenden governementality studies heraus. Foucaults reflexhafter Antimarxismus stünde dabei seinem eigenen Anspruch im Wege, gerade die Verbindung von Herrschaft und Subjektivierung zu denken, die doch genuiner Gegenstand der Ideologietheorie ist (138). Der Gegenentwurf seines Gouvernementalitätsbegriffs bekomme diese Schwäche nicht eingeholt, bliebe konzeptuell unklar und verschleiere kapitalistische Herrschaftsverhältnisse bis hin zur Affirmation (144 ff.). Rehmann plädiert daher zurecht dafür, die Leistungen der Foucaultschen Analyse als Teil einer Ideologietheorie zu betrachten, statt als deren Ersatz.
Immer wieder ist damit angesprochen, dass die symptomatische Entwicklung Foucaults die Gesellschaftstheorie quasi als Ganzes betrifft, ihre Gegenstände wie auch ihr Operationsniveau. Diese Zusammenhänge zwischen der Produktionsweise der gesellschaftlichen Realität und der Produktion des Denkens herzustellen, bedarf ja bereits einer Gesellschaftstheorie, die auf dem Standpunkt der Totalität und Determination steht, welche Foucault paradigmatisch verunmöglichte. Dieser Erkenntnisschritt wird aber nicht in letzter Konsequenz gegangen. Vielmehr beschränkt sich die Abschlussbetrachtung auf die Feststellung der persönlichen Motivation Foucaults, dessen begriffliche Verfehlungen und letztlich den Vorwurf, Foucault könne trotz oder wegen seiner Affinität, die Spezifik des Neoliberalismus nicht begreifen: „How is it, that the man who is arguably the most discussed thinker of our era seems simultaneously essential and woefully inadequate to conceptualizing what is perhaps the critical iddue of our age – the hegemony of globalized neoliberalism?“ (183) Das Wundern über diesen Zusammenhang unterwandert den Erkenntnisstand der Beiträge, deren Gewinn doch gerade darin gelegen hätte, auf die Notwednigkeit hinzuweisen, mit der Foucault eine gesellschaftliche Realität verkennt, die er genau darin affirmieren muss. In diesem Rückschritt aber verfallen die Beiträge wieder in Einzelkritiken oder doch nur polemische Spitzen und erschöpfen sich womöglich nur darin zu diskutieren, wie Foucault in Detailfragen zu bewerten sei.
Zamora, Daniel/Behrent, Michael C. (Hrsg.) 2016: Foucault and Neoliberalism. Cambridge: Polity Press.
von Alex Struwe