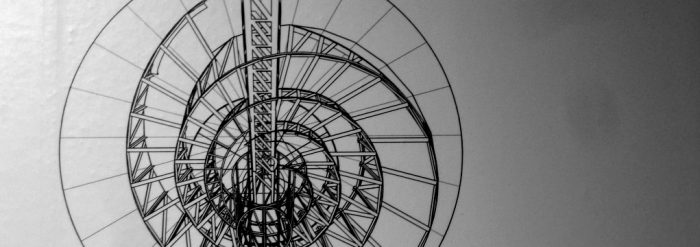Drei kurze Besprechungen zu den Tagungsbänden der jeweiligen Konferenzen Die Idee des Kommunismus.
Die Möglichkeit, den Kommunismus über die Geschichte der gescheiterten Versuche seiner Umsetzung hinaus zu retten, besteht darin, ihn als Idee zu begreifen. Alain Badious einflussreiche kommunistische Hypothese setzte genau diesen Impuls und vermochte damit auch das Ende der Apathie einer Linken nach dem Zusammenbruch des Sozialismus zu artikulieren. Was an diesem vermeintlichen Neuanfang „zunächst und vor allem zählt, ist die Existenz des Kommunismus und sind die Begriffe, in denen er formuliert wird“ (26). Der Aufgabe dieser Reformulierung widmete sich die bereits 2009 abgehaltene Konferenz zur Idee des Kommunismus, deren Beiträge hiermit auf Deutsch vorliegen. Darin versammelt sich eine namhafte Prominenz radikaler Philosoph_innen, die sich entweder direkt der Aufgabe verschreiben oder deren Arbeiten auf jenes Vorhaben hin kontextualisiert werden. Der Einigkeit über die Dringlichkeit der aktualisierten kommunistischen Idee, wie sie Badiou eingangs formuliert, stehen dann schnell die unterschiedlichen Interpretationen und verschiedenen Probleme gegenüber, mit denen sich ein solches Projekt konfrontiert sieht. So steht Kritik von Susan Buck‑Morss an einer falschen, weil exklusiv westlichen, Universalisierung des Kommunismus neben den Ausführungen Terry Eagletons über das Dilemma der Produktivität, welches wiederum von Michael Hardt aufgegriffen und optimistisch gewendet wird, da sich im aktuellen Stadium des Kapitalismus eine Produktion von Gemeingut durchsetze, die zur Grundlage seiner eigenen Überwindung diene. Die zumeist subtilen Bezüge aufeinander sind dabei nicht immer leicht nachzuvollziehen, wenn beispielsweise Žižek zwischen den Zeilen Rancière eines Neu‑Kantianismus bezichtigt oder dieser gleich „von seinem älteren Klassenkameraden Badiou wegen radikalem ‚Apolitizismus‘ angeklagt“ (54) wird. Einigkeit besteht daher nur in wenigen Punkten, so aber zumindest darin, dass der Neubeginn nicht als positives Programm vorweggenommen werden kann. Damit bleibt die vermeintliche Universalie etwas Negatives und dient so vielmehr einer generellen Herausforderung des Status quo, als dieser Bewegung substanziell eine Richtung geben zu können. So etwa, wenn Jacques Rancière den Kommunismus als die Emanzipation der Intelligenzen der Einzelnen im Namen der Gleichheit beschreibt oder Gianni Vattimo fordert, „der Kommunismus muss den Mut haben, ein ‚Gespenst‘ zu sein“ (249).
Douzinas, Costas/Žižek, Slavoj 2012 (Hrsg.): Die Idee des Kommunismus. Band I. Hamburg: LAIKA.
„Die Idee des Kommunismus ist […] der Gegenstand einer Hypothese über die Möglichkeitsbedingungen einer politischen Wahrheit“ (110), konstatieren die deutschen Mitorganisatoren der zweiten Konferenz zur Idee des Kommunismus Gernot Kamecke und Henning Teschke. Mit dieser Aussage betonen sie die Relevanz des Vorhabens einer Aktualisierung des Begriffs und der Bewegung, wie sie bereits im Vorjahr 2009 thematisiert wurde. Ein impliziter Schwerpunkt liegt nun auf Fragen der Subjektivität, denn, wie Alain Badiou ausführt, stellt die kommunistische Idee jene Form einer notwendigen Universalität dar, „ohne [… die] es keine Realität des politischen Subjekts der Emanzipation [gibt]“ (12). Für ihn ist daher eine erneuerte Internationale der unbedingte Bezugspunkt einer kommunistischen Bewegung. Auch Saroj Giri führt das Nachdenken über die Möglichkeiten des Kommunismus zwangsweise zu Fragen der revolutionären Subjektivität zurück, da es „genau die konkrete historische Möglichkeit der Entwicklung politischer Formen und die Konstituierung der Gesellschaft auf einer kommunistischen Basis [… ist], die Badiou bei seinem Begriff der kommunistischen Idee übersieht“ (61) und die es folglich auszuloten gilt. Das Kollektiv „Golden Poldex“ sieht im politischen Subjekt der Solidarno?? bereits die (zwar gescheiterte) historische Verwirklichung der kommunistischen Hypothese Badious, um diese so in die Zukunft zu projizieren. Eine ähnliche Verbindung betonen auch Frank Ruda und Jan Völkers, die eine kommunistische Maxime daher verstehen als „den Mut, die Bilanzierung des eigenen Daseins, der eigenen Geschichte aufzunehmen, um daraus das Vertrauen in die Fähigkeiten für das Neue zu entwickeln“ (195). Ein weiterer Schwerpunkt findet sich quasi in negativer Gestalt in der Austragung von Konfliktlinien, wie es an der Kontroverse zwischen Badiou und Antonio Negri wohl am deutlichsten wird, die die Verlängerung alter Debatten zwischen einem vermeintlichen „Monopolkommunismus“ der Wahrheitsprozedur und der Berufung auf die Immanenz und Affekte des omnipräsenten politischen Kampfes darstellt. Als letzte Schwerpunktsetzung gilt den Organisatoren die besondere Stellung von Beiträgen aus dem postsowjetischen Raum, die der tendenziellen Idealisierung des Kommunismusbegriffs auch eine Art Realitätserfahrung beisteuern können, ohne diese zum Beweis des Utopismus zu missbrauchen.
Badiou, Alain/Žižek, Slavoj 2012 (Hrsg.): Die Idee des Kommunismus. Band II. Hamburg: LAIKA.
Nur selten gehen die Protagonisten der neuen Idee des Kommunismus so selbstkritisch vor wie in dem dritten Band dieser Reihe. Alain Badiou knüpft an die besten Momente seiner kommunistischen Hypothese an. Er vertieft seine Analyse über Gewaltherrschaft und Terror in revolutionären Situationen sowie die darin aufscheinende, seltsame „Faszination für den Feind“ und „mimetische Rivalität“ (20) der gegenseitigen Überbietung an Entfremdung im Systemwettbewerb. Étienne Balibar diskutiert die „bemerkenswert entgegengesetzten Sichtweisen auf die Revolution“ (36) zwischen den biopolitischen und ideologiekritischen Strömungen des Postmarxismus und kommt zum Schluss, dass vor allem erstere die dem Spätkapitalismus eigenen, „gigantischen Formen von Standardisierung und Mechanisierung“ der Arbeit „ignorieren oder minimieren“ (45). Dadurch scheinen die vielfältigen Hoffnungen auf die Emergenz kommunistischer Muster aus der bestehenden Ordnung plötzlich sehr fragwürdig zu sein. Susan Buck‑Morss holt noch weiter aus und erteilt allen existenzialistischen Versuchen – im Geiste etwa des Operaismus und des Heideggerianismus –, linke Politik aus der Mikrophysik der unmittelbaren Unterdrückung abzuleiten, eine klare Absage: „Tatsächlich ist das Ontologische niemals politisch. Eine commonistische (oder kommunistische) Ontologie ist ein Widerspruch in sich“ (75). Und auch der scheinbar unendliche Horizont der Philosophie vom wahrhaften politischen Ereignis wird begrenzt: „Das, was in einem Ereignis plötzlich möglich ist, besteht darin, den selbsterklärten Demokratien zu folgen, die bereits etabliert sind“ (85). Jodi Dean sekundiert mit einer vernichtenden Kritik von Wendy Browns einflussreicher Interpretation von Walter Benjamin: „Brown legt nahe, die Linke sei in Folge historischer Veränderungen besiegt und verlassen worden. Benjamin nötigt uns zu erwägen, dass die Linke aufgegeben und sich verkauft hat“ (106). Der falsche Individualismus und das heimliche „Genießen, [das die Linke] durch ihren Rückzug aus der Verantwortung“ (109) gewinnt, wird laut Dean auch von Antonio Negri und Alain Badiou nur unzureichend aufgelöst. Statt Idee, Ereignis, Singularität sollte sich linke Theorie wieder dem Thema der Massen zuwenden. Denn: „Statt eine Identität zu benennen, unterstreicht die Zahl [der Masse] eine Teilung und eine Lücke“ (124), wirke also ganz und gar kritisch im besten marxschen Sinne. Insgesamt handelt es sich sicher um einen der streitbarsten und zugänglichsten Bände zum Thema.
Badiou, Alain/Žižek, Slavoj 2015 (Hrsg.): Die Idee des Kommunismus. Band III. Hamburg: LAIKA.
von Florian Geisler/Alex Struwe
Die Beiträge erschienen zuerst auf Portal für Politikwissenschaft, URL: https://www.pw-portal.de/rezension/38609-die-idee-des-kommunismus-band-iii_45713