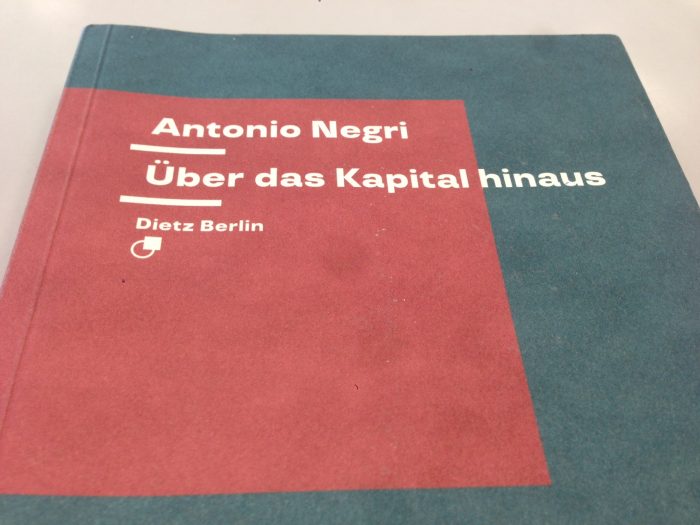Eine Besprechung der deutschen Erstausgabe von Negris Vorlesung von 1979 ist eine undankbare Aufgabe. Nicht weil sie schwer zu lesen wäre – im Gegenteil, Negris Buch gehört sicher zu den zugänglichsten Marx-Kommentaren, die man finden kann. Und auch an der politischen Integrität von Negri, der lange für seinen Kampf gegen den italienischen Staat im Gefängnis saß kann kaum ein Zweifel bestehen. Und doch: Trotz seiner Verdienste erscheint Negris Darstellung des politischen Gehalts des Marxismus im Kern irreführend.
Fragestellungen
Negri, so scheint es zumindest, beginnt seine Rekonstruktion von Marx’ Grundrissen nicht mit einer klaren Fragestellung. Stattdessen zielt Negri auf Antworten: „Der Kommunismus kann nicht die Korrektur der Disharmonien des Kapitals sein“, heißt es (83) beispielsweise. Doch auf welche Frage ist das die Antwort? Erstens verkauft niemand (mehr) Reformen als Kommunismus. Zweitens liegt die Bringschuld gerade auf der anderen Seite: der Kommunismus müsste der Mehrheit der Menschen überhaupt mal aufzeigen, dass er den Disharmonien des Kapitals vorzuziehen ist. Warum das nicht gelingt, wäre eine Fragestellung, die zu klären sich für die heutige (post-)operaistische Linke lohnen könnte.
Die große historische Frage des italienischen Kommunismus war, ob er sich um Kompromiss und Ausgleich mit den gemäßigten und liberalen Kräften bemühen sollte. Doch diese historische Phase ist vorbei, und selbst wenn sie noch aktuell wäre müsste hinterfragt werden, ob der Rückgriff auf Marx’ Schriften nicht, im besten Fall, einen holprigen Umweg über die Philosophie darstellt, wo die direkte Rede über die Ziele der Bewegung versperrt ist, im schlechtesten Fall aber nur ein Autoritätsargument ist.
Heute allerdings haben sich die Fragestellungen in eine andere Richtung entwickelt. Wo ist ‚die kommunistische Bewegung‘ die durch einen mahnend gehobenen Finger davon abgehalten werden könnte, einen falschen Kompromiss einzugehen? Können wir uns wirklich sicher sein, dass z. B. der Klima-Aktivismus, der Kampf gegen die westlichen Grenzregime oder der radikale Feminismus sich ausgerechnet durch die mahnenden Worte des frühen Marx auf einen konsequenten Kurs „gegen das System“ einschwören lassen? Es scheint relativ klar, dass mit großen antikapitalistischen Worten bei diesen Protestformen kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Und zwar zurecht, denn der Nachweis, dass und warum es denn nicht reicht, freie Marktwirtschaften sozial zu regulieren, ist noch viel weniger ausgearbeitet und plausibel als noch vor hundert Jahren.
Zwischen den theoretischen Überlegungen beginnend bei Marx und Engels, Lenin, Luxemburg Liebknecht und wie sie alle heißen und der Theorie heutiger Tage liegt eine Geschichte gründlichster intellektueller Enteignung, der auch gerade durch viele akademische „Rekonstruktionsversuche“ des Marxismus ihren Weg gebahnt bekam. Nur konsequent, dass es Greta Thunberg heute nicht im geringsten einleuchtet, warum demonstrieren und reformieren nichts erreichen können sollte, wenn es doch so offensichtlich eine so große progressive Wirkung entfaltet. Populären Bewegungen dieser Art ist das große Ganze hinter den sozialen Problemen egal, sie suchen ihr Heil darin, ohne Vorurteile pragmatische Lösungen zu finden. Die eigentlich kritische Frage aber – warum, zum Teufel, denn nicht früher etwas unternommen worden wäre, warum es z.B. erst ausgerechnet einen Schulstreik braucht, damit etwas gegen den Klimawandel unternommen wird – wird dabei unter den Teppich gekehrt. Man möchte sich von allzu kritischem Nachfragen schließlich auch nicht die Zustimmung der breiten Massen vergraulen.
Derweil guckt der Teil der Menschen, der immernoch daran glaubt, dass dieses „Staatsversagen“, das sich in den Klimastreiks ausdrückt, eben keinen Zufall darstellt, sondern das ganz normale business as usual einer im großen und ganzen immernoch imperialen Weltordnung ist, in die Röhre. Dabei könnte er wohl zur einen oder anderen wichtigen Erkenntnis gelangen, würde er sich trauen, die Grundfragen seiner Weltsicht einmal ernsthaft, und nicht nur rhetorisch, zu stellen: Was ist die Verbindung von Kapitalismus und Umweltzerstörung? Was ist die Verbindung zwischen ArbeiterInnen- und Frauen*bewegung? Was ist die Intersektion von Rassismus, Nationalismus und Kapital? Können wir diese Fragen denn wirklich nicht beantworten, ohne in den immergleichen überholten Jargon zurückzufallen?
Auch Negri scheint diese Frage einfach mit einem der große nachdrücklichen Appell an den echten Marx, in diesem Fall eben den der Grundrisse: „Gibt es jemanden, der denken würde, Marx stünde auf diesem Gebiet, wenn es um Produktion und Fabrik geht … nicht auf einer Seite? Das heißt, nicht auf der Seite der Arbeitenden?“ (73) schiebt Negri alle Zweifel beiseite. Negri bleibt hier resistent gegen jede Irritation – übersetzt heißt die Passage doch nichts anderes als: ‚Marx steht auf der Seite der Arbeitenden, und Marx hat immer recht, deswegen haben auch die Arbeitenden immer recht‘. Die Kritik verengt sich damit auf eine kämpferische, aber umso plattere Rechthaberei. Das mag für 1979 eine richtige Medizin gewesen sein. Doch aus heutiger Sicht – und wie könnten wir diesen Text nicht aus der Sicht der heutigen Lage und der gegenwärtigen Klassenkämpfe sehen, ohne Negri Unrecht zu tun, der sich selbst bestimmt nicht gerne als Museumsstück studiert sehen würde – wir eben klarer und klarer, dass der Kommunismus eben nicht nur eine Frage von Produktion und Fabrik ist. Es wird klar, dass ein sich reformierender Kapitalismus ganz und gar keinen Widerspruch-in-sich darstellt. Es wird klar, dass viele bürgerlich geführte und oft national gefärbte, in jedem Fall ganz und gar un-internationalistische Bewegungen zu Feminismus und Antikolonialismus für viele Generationen leider die absolute Normalität und oft das einzige Handlungsfeld darstellen. Von großen Reden über die Aktualität von Marx wird sich diese Realität nicht umkehren lassen.
Negris tendenziöse Analyse von Gebrauchs- und Tauschwert kann in so einem Umfeld nicht punkten. Natürlich wurde schon lange vor Negri immer wieder eine angebliche Dialektik des Werts ins Spiel gebracht, um eine kathartische Heilserzählung über das Ende des Kapitals zu begründen. Gebrauchs- und Tauschwert stünden im Widerspruch zueinander, also müssen wir den Kapitalismus abschaffen, klar oder? – Nein, leider überhaupt nicht klar, und außer einem immer kleiner werdenden Kreis aus Interessierten oder sogar Sympathisanten mit der Marx’schen Sache auch wenig einsichtig. Besser, als die vorgeschützte Einsicht in eine mystische Logik des Widerspruchs zum Gatekeeper für linke Theorie zu machen, wäre es, den politischen Gehalt des revolutionären Marxismus erst einmal in einfacher Sprache zu rekonstruieren.
Negri versucht nun, diese Frage methodologisch einzuholen: „Wir … wollen bestimmen, wie, nach welchem formalen Mechanismus, die Differenz [von Gebrauchs- und Tauschwert] zum Antagonismus wird.“ (80) Tatsächlich ist das genau die Frage, die zu klären wäre. Doch Negri hält sein Versprechen leider nicht. Negris Ergebnis, in wenige Worte zusammengefasst: Es gibt einen Weltmarkt, und auch auf ihm gibt es genau wie in nationalen Märkten manchmal Disharmonien. Das ist sicher richtig, aber was das für die von Negri behauptete neue Rolle des Subjekts in der Geschichte bedeutet, worin sie also besteht, die angekündigte „neue Insurrektion der lebendigen Arbeit“ (17), bleibt dem Leser so verschlossen.
Alles neu macht Marx
Ähnlich verhält es sich mit seiner Darstellung von Ausbeutung und Krise. Negri blickt auf eine „neue Qualitätder Ausbeutung“, die sich „nicht einfach durch die im Arbeitsprozess erzeugten Werte definieren oder mit ihnen ins Verhältnis setzen lässt“ und sich daraus ergibt, „dass die gesellschaftliche Arbeit in ihrer Gesamtheit und unentgeltlich produktiv ist“. Der „Profit ist daher in erster Linie gesellschaftlicher Ausdruck des Mehrwerts in seiner Gesamtheit, einschließlich der unentgeltlichen Ausbeutung der gesellschaftlichen Produktivkräfte“ (122). Prinzipiell wäre das ein zentrales Themenfeld etwa für eine heutige Auseinandersetzung über unbezahlte Reproduktionsarbeit. Allein, die Frage, was denn diese neue Qualität denn sei, bleibt unbestimmt. Es klingt bei Negri gerade so, als wäre es schon längst ein alter Hut, Ausbeutung mit dem Arbeitsprozess, mit der internationalen oder vergeschlechtlichten Arbeitsteilung in Beziehung zu setzen. Dabei stehen wir doch vielmehr erst am Anfang von solchen Unternehmungen.
Negri zielt auf die „Analyse der Krise als Form der Zirkulation“ (131) und erwähnt Prozesse der Entwertung, die ja tatsächlich überall zu finden sind und wohl bei einer Berechnung des berühmten Profitratenfalls nicht außen vor bleiben können. Doch auch hier ist keine offene Fragestellung in Sicht – und das ist das Paradoxe an Negris Rekonstruktion: Obwohl er sich den großen begrifflichen Schwierigkeiten im Apparat der Marxschen Ökonomiekritik durchaus bewusst ist, will er dennoch an keiner Stelle ernsthaft über diese Grenzen sprechen, will die Probleme an keiner Stelle wirklich lösen. Sobald eine inhaltliche Schwierigkeit auftaucht kommt wie von Zauberhand stets eine neue Dialektik oder ein noch komplexerer Widerspruch um die Ecke. Es scheint dabei insgesamt so, als wäre jeweils das „Neue“ an der „neuen Ausbeutung“ immer viel wichtiger als die Ausbeutung selbst.
Wir kennen das sonst aus Diskussionen um Neoliberalismus und die Erweiterung kapitalistischer Muster um eine neue Weise des Regierens. Doch der Fokus auf das angeblich Neue in einer neuen Phase des Kapitalismus führt in die Irre, wenn noch nicht einmal die alte Phase verstanden ist. Eine Linke lügt sich selber in die Tasche, wenn sie glaubt, die Novität eines neuen wohlklingenden Arguments allein reiche aus, um die Krise des Marxismus zu überwinden – abgesehen davon selbstverständlich, dass Negris Sichtweise heute ja schon längst nicht mehr „neu“ ist, sondern eben als Wissenschaft von der „Biopolitik“ längst akademische Weihen empfangen hat und zu Weltbestsellern glattgebügelt wurde.
Kapital und Subjekt
„Über das Kapital hinaus“ ist daher tatsächlich ein bedeutendes Dokument der Genealogie des Paradigmas der Biopolitik und als solches sowohl seinen Anhängern als auch seinen Kritikern zur Lektüre empfohlen. Eine zentrale These des späteren Diskurses ist hier bereits enthalten, nämlich die befürchtete unmittelbare Kolonisation „des Lebens selbst“ durch den Kapitalismus, wie es heißt.
Negri schreibt über den eigentlichen Erkenntnisgehalt der Grundrisse: „Allzu oft ist Marx’ Text als einfache Geschichtsschreibung der kapitalistischen Entwicklung gelesen worden. Doch das trifft nicht zu. … Der wahre Schlüssel des Erkenntnisprozesses: Eine zunehmende Annäherung an die Komplexität des revolutionären Subjekts, auf der realen Ebene des Klassenkampfs. … Das Subjekt wird immer wirklicher, immer konkreter, die von der Mehrwerttheorie beschriebene Zellstruktur wird körperlich, wird belebte, vollständige Realität.“ (147) Weiter heißt es: „Ab einem bestimmten Zeitpunkt, sobald nämlich das Kapital als »gesellschaftliches Kapital« konstituiert, wird es nicht mehr möglich sein, Arbeit vom Kapital, Arbeit vom gesellschaftlichen Kapital und vom Verwertungsprozess zu unterschieden“ (165).
Negris beschwörender Gestus, der sich in seinen späteren Schriften noch verdoppeln und verdreifachen sollte, überschätzt die Unmittelbarkeit des Kapitalismus in ähnlichem Maßstab, wie er seine tatsächliche Komplexität unterbewertet. Selbst heute, in einer Welt mit unendlich weiter entwickelten Methoden zur technischen Unterdrückung und Zergliederung der Arbeit, kann von einer unmittelbar realen, belebten Struktur des Kapitals keine Rede sein. Ernste Frage: Wo wäre die denn zu finden? Selbst der zerstückelte Arbeitstag eines modernen scheinselbstständigen Fahrradkuriers kann nicht darüber hinwegtäuschen, wohin am Ende der erwirtschaftete Überschuss geht: an die Inhaber der Server und an die Vermieter der eigenen trostlosen vier Wände. Weil ihm sein Fahrrad selbst gehört, soll Arbeit und Kapital ununterscheidbar sein und auf sein „Leben selbst“ zugreifen? Das erscheint wenig plausibel. Dabei suggeriert Negris Redensart, alle Interpretationsschwierigkeiten seien in dieser Form ein Problem der Zukunft: Wenn sich das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis setzt, also die Gesellschaft „lückenlos und umfassend“ (165) beherrscht, dann solle es schwer werden, Arbeit und Verwertung zu unterscheiden. Doch ist es nicht gerade so, dass schon jetzt das Rätsel der Verwertung und Reproduktion noch nicht gelöst ist?
Positionen und Konjunkturen der Kritik
Negri positioniert sich mit dieser Vorgehensweise gegen die Lesart, die von Louis Althusser hervorgehoben wurde, der Negri zuerst für diese Vorlesung an die Universität gebracht hatte (259). Althusser hatte eine Zeit lang versucht, eine humanistische Version linker Politik zurückzudrängen, die immer nur die Scherben zusammenkehrt und die Wunden näht, die das System mit jedem Zyklus neu ins Fleisch der Gesellschaft schlägt. Negri dagegen: „In [der] wilden Einforderung des Kommunismus als Befreiung von Ausbeutung hat man bisweilen Elemente von Individualismus oder humanistischen Mitleids gesehen. Selbst wenn dem so wäre, gäbe es daran nichts auszusetzen.“ (194) Kann dieser teils ennervierende Gestus des „Wilden Kommunismus“ eine Orientierung für heutige Bewegungen geben? Ich glaube nicht. Zumindest bleibt erklärungsbedürftig, warum ein solcher vermeintlich radikal-kommunistischer Flügel sich heute in demokratischen Initiativen wie DiEM25 kanalisiert, die weder durch eine Orientierung an der Arbeiter*innenklasse noch durch eine nachdrücklich antikapitalistische Haltung auffallen.
Lesenotiz zu Antonio Negri | Über das Kapital hinaus| 2019 | Karl Dietz | 29,90 € | 263 S.