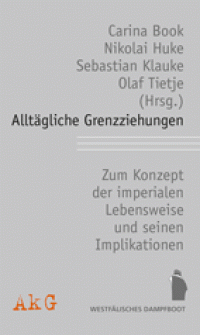
Zur “Festung Europa” gehört nicht nur die rigorose Abschottung nach Außen hin, sondern auch eine ganz bestimmte Lebensart auf der Innenseite, oberflächlich gekennzeichnet von hohen Konsumstandards und riesigem Energie- und Ressourcenverbrauch. Tatsächlich kann man sagen, dass es allen politischen Akteuren und Strömungen – nicht nur den SozialistInnen – schwer fällt, gegen diese Lebensweise vorzugehen. Eine Beschränkung der Konsumerwartung der Massen ist schwer zu legitimieren im Angsichts der immer weiter aufgegangenen Schere zwischen Arm und Reich. Aber auch materiell sind die vielen mikroskopischen “Verbesserungen” des Alltags – Plastikverpackungen für alles, Elektronische “Hilfen” für jede erdenkliche Situation, ein Smartphone als Grundvoraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen Leben vom zugänglichen Bahnticket bis zum Leihrolle – nicht einfach durch grüne Appelle zu tilgen. Wer ohnehin vor der Wahl steht, entweder einen gesunden Schlafrhythmus durchzuhalten oder pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, dem wird es dreifach schwerfallen, auf den tragbaren Cappuccino zu verzichten. Auch die Überflutung des Kontinents mit Elektronik aus Asien ist schlicht nicht realisierbar ohne die großen Containerflotten und die billige Verklappung der Altgeräte ebendort.
Im marktliberalen System können – bis auf wenige Ausnahmen, etwa den plötzlichen Atomausstieg – umweltschonendere und sozial verträglichere Konsumweisen größtenteils vermittelt über Preise gesteuert werden, also etwa durch höhere Steuern auf fossilen Treibstoff oder Gebühren für Plastik. In der Praxis laufen solche Maßnahmen aber der Realität meist nur hinterher: Stets zu spät, stets zu wenig, um wirklich einen Effekt zu erzielen. Der Überschuss, der verteilt werden muss, um auch “dem kleinen Mann” einen “fairen” Konsum zu ermöglichen, muss erst erwirtschaftet werden. Und erwirtschaftet wird er eben imperial: Durch gewollte Aufrechterhaltung internationaler Entwicklungs- und Handelsungleichgewichte. Die Peripherien haben nur die Wahl, ihre untergeordnete Stellung im globalen Machtsystem zu akzeptieren und zu hoffen, dass über Jahrzehnte andauernde Prozesse ein Ausgleich der Bedinungen entsteht.
Derweil arbeiten natürlich die gewählten Eliten der imperialen Zentren daran – rechte wie sozialliberale – diesen Ausgleich um jeden Preis zu verhindern. Hatte nun gerade eine neue Generation entdeckt, dass die Hoffnungen auf einen Wandel in der Perpipherie nicht realistisch sind, haben sich westlichen Eliten daran gemacht, ihre ohnehin strikt reglementierten Grenzen gegen die einzig vernünftige Konsquenz – fliehen, solange es noch geht – abzudichten, mit tatkräftiger Unterstützung eines großen Teils der “eigenen” werktätigen Bevölkerung, die überhaupt nicht daran denkt, sich für die Ärmsten gerade zu machen. Nicht unbedingt, weil sie per se schlechte Menschen wären, sondern eher, weil ihnen die großen “linken” Parteien und Gewerschaften jeden solidarischen Grundimpuls gründlich abtrainiert hatten, um dadurch ihren eigenen Stand in der sozialen Hackordnung nicht zu gefährden.
Der Mechanismus der “Externalisierungsgesellschaft”, wie ihn etwa Stephan Lessenich beschreibt, ist also kein neues politisches Phänomen im Spätkapitalismus oder nur eine der “Formen der Krisenbearbeitung seit 2008” (20), wie man es beim Aufschlag für den Begriff der “imperialen Lebensweise als Forschungsprogramm” vermuten könnte. Der systematische Drang der politischen Vertreter der weniger privilegierten, das Lebensniveau ihres Elektorats auf Kosten dritter zu heben, ist so alt wie die Idee der demokratischen Wahl selbst.
Insofern ist eine gewisse Vorsicht angebracht, wie Lukas Oberndorfer erneut von “klaren Zeichen für die Krise der einst führenden Weltanschauung” (44) zu sprechen. Der Gedanke ist simpel: Die Gesamtkrise ist da und wird autoritär gelöst, wo sie doch auch progressiv gelöst werden könnte. Es gibt aber ebensoviele Anzeichen dafür, dass es sich bei dieser Sichtweise um einen Fehlschluss handelt. Nötig wäre vielmehr, die geradezu bedrohliche Stabilität der Institutionen und imperialen Lebensweise zu untersuchen. Wir erinnern uns an ebenso spektakuläre wie folgenlose Einzelfälle: Horrende Enthüllungen von Journalisten, über die Korruption von einzelnen Staatsoberhäuptern sowie berechtigten Generalverdacht über Betrug und Steuerhinterziehung von der politischen Klasse generell; aber auch bis hin zu ganz und gar dystopischen und ebenso folgenlosen Vorgängen, wie das Einrichten von geheimen technischen Sonderabteilungen bei großen Automobilfirmen, um systematisch staatliche Umweltkontrollen zu umgehen. Die erwarteten Hegemoniekrisen bleiben bei all dem flächendeckend aus. Sebst der bemerkenswerteste Aufstand, die Regierung Syrizas, wurde schlicht wieder abgewählt.
Der Fokus auf ein Gramscianisches Krisenverständnis verstellt hier die Erkenntnis: “Die Krise der Demokratie sei verantwortlich gewesen, dass sich keine tragfähige Exitstrategie [aus der Finanzkrise, FG] etablieren konnte”, zitiert Oberndorfer Stephen Gill und Ingar Solty. Das scheint nicht plausibel, da die Krisenlösungsstrategien über den langen Zeitraum seit mindestens 2007 ja mehrfach zur demokratischen Wahl standen, und nie – mit Ausnahme allein Griechenlands – Alternativen eine nennenswerte Traktion gewinnen konnten. Es handelt sich also wohl nicht um eine Hegemoniekrise, sondern geradezu um die finest hour des Neoliberalismus: Möge er auch ökonomisch scheitern, verliert er dennoch nicht seine Stellung als hegemoniale Ideologie. Das neue Staatsregime stellt nicht einfach die Sicherheitsfrage in all ihren Facetten als das wichtigste Allgemeingut dar, und die Menschen fallen darauf herein – vielmehr haben die Menschen in den Zentren offenbar ein Interesse an dieser, wenn man so will: biopolitischen, Sicherheit, das von den neuen politischen Figuren wie Johnson, wie Trump, wie Salvini, treffend und wahrhaftig artikuliert wird.
Ohne eine Artikulation einer politischen Antithese dazu, ohne dem Ziehen einer klaren Grenze, ohne letztendlich ein ganz anderes Politikmodell als dem Greifen nach der Hegemoniekrise wird sich die Linke möglicherweise schwer tun, gegen diese Konstellation glaubwürdig zu werden.
(Ausschweifende) Lesenotiz zum AKG-Sonderband 2019, Teil II: Das Problem mit der Hegemonie
Carina Book, Nikolai Huke, Sebastian Klauke, Olaf Tietje (Hrsg.) | Alltägliche Grenzziehungen | Das Konzept der »Imperialen Lebensweise«, Externalisierung und exklusive Solidarität | 2019 | Westfälisches Dampfboot | 25€

