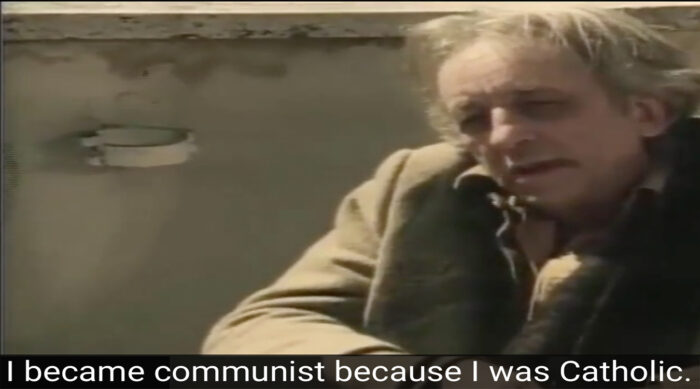Marx oder Spinoza?
Nachlesenotiz zu Katja Diefenbach: Spekulativer Materialismus | 2018 | Wien: Turia+Kant | 604 Seiten | 978–3‑85132–888‑2
Die vielzitierte »Reproduktion der Produktionsverhältnisse« – sie ist nicht nur eine komplizierte Floskel für ein eigentlich banales Problem, sondern eine soziologische und philosophische Herausforderung. Man kann zwar heute berechtigterweise der Meinung sein, dass das Phänomen der Stabilität, ja regelrechten Resilienz des Kapitalismus als historische Formation besser ohne den Ballast von Althussers Strukturalismus erklärt und bekämpft werden kann, auf den diese Formulierung zurückgeht. Doch selbst dann kann es nicht schaden, sich die Situation in den 1960er und 1970er Jahren bewusst zu machen und zu verstehen, auf welche Probleme die philosophischen Versuche dieser Jahre überhaupt reagieren, deren Lösungsvorschläge zwar oft in unseren heutigen Sprachgebrauch eingegangen sind, ohne wir uns über ihre Tragweite im Klaren wären.
Spinoza und die Fragestellung des Postmarxismus
Katja Diefenbachs Buch lässt sich als Beitrag zu einem solchen Forschungsprogramm zur Entstehung von Theorien verstehen, das helfen soll, aktuelle Schwierigkeiten besser zu umfahren. Alles beginnt mit der Feststellung, dass die Philosophie des Niederländers Baruch de Spinoza aus dem 17. Jahrhundert eine Menge zu den modernen Fragen zur politischen Berufung der Philosophie zu sagen hat. Diefenbach selbst versteht ihr Projekt genau so: Nicht als scholastische Rekonstruktion, „sondern als theoriepolitischen Eingriff“, um den „differenziallogischen Charakter von Spinozas Denken und die damit verbundene politische Originalität … für die heutigen Kontroversen um den Begriff der Politik“ (17) herauszuarbeiten.
Diefenbach erinnert dafür zunächst an die bekannte Problemdefinition Althussers: Gerade weil die Lohnarbeit meist nicht durch unmittelbare Gewalt erzwungen wird, sondern ganz im Gegenteil genauso bezahlt wird, wie jede andere Ware, nämlich auf Grundlage der geschätzten Kosten für Ihre Herstellung, herrscht im Kapitalismus eine immense Ideologie juristischer Gleichheit – Kapital und Arbeit als gleiche Partner, in deren Austauschprozess am Ende dennoch mehr Wert entsteht, als am Anfang hineingeworfen wurde. Man mag diesen Prozess zurecht kritisieren. Fakt ist aber, dass die Anerkennung einer solchen abstrakten Gleichheit einen erheblichen Integrationsfaktor für die moderne Gesellschaft darstellt. An vielen Orten wurden die Klassenkämpfe als scheinbare Motoren der Geschichte fast stillgestellt. Dies ist, laut Althusser, eben nicht nur ein politisches, sondern ein philosophisches Problem, denn es berührt direkt unser Verständnis von Kausalität im Bereich der Politik. Wenn es nicht Ökonomie und Mehrwert sind, die die Politik vorherbestimmen, was ist es dann? Gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit, Politik als etwas zu denken, was regeln gehorcht, oder muss man eingestehen, dass Politik letztendlich beliebig, zufällig oder kontingent ist? Kann, mit anderen Worten, Materialismus überhaupt noch als Wissenschaft von der Determination sozialer Systeme deuten? Diefenbach fasst Althussers Problemstellung folgendermaßen zusammen:
“Für Althusser bezeichnet der Begriff des Mehrwerts nichts anderes als ‚seinen eigenen Inadäquationsbereich‘. Damit hört die Ökonomie auf, Träger von Essentialismus und Notwendigkeit im Hegel’schen Sinne zu sein. … [D]ass ‚die einsame Stunde der letzten Instanz nie schlägt‘, drückt eine … Widerspruchsbeziehung aus, in der das bestimmende Momentum durch das, was es determiniert, redeterminiert wird. Diesem Schema der Überdetermination gibt Althusser … einen neuen Namen – immanente, strukturale oder metonymische Kausalität.” (28)
An diesem Problem der strukturalen Kausalität hat sich, ohne viele Erfolge vorweisen zu können, eine ganze Generation die Zähne ausgebissen. Heute ist es weitgehend in den Archiven verschwunden, nachdem sich das sozialwissenschaftliche Interesse in ganz andere Bereiche verlagert hat. Diefenbach tritt nun allerdings dafür ein, dass das Problem bereits lange vor Althusser, nämlich bei Spinoza, eine ganz hervorragende praxisphilosophische Formulierung erfahren hat, die viele der gordischen Knoten der Vergangenheit durchschlägt und auch heute von großem Nutzen sein könnte, weshalb sie die diese Formulierung durch alle Facetten, Phasen und späteren Interpretationen hindurch rekonstruieren möchte. Schon allein durch den Umfang der Rekonstruktion, aber auch in ihrer politischen Analyse, geht Diefenbachs Arbeit weit über den Rahmen vergleichbarer Studien hinaus.[1]
Deutlich werden dabei vor allem zwei Dinge. Erstens: Die Aneignung von Spinoza ist umkämpft. Zweitens: Spinozas Argumenten ist, vergleichbar vielleicht mit dem Fall Antonio Gramscis, nicht in reiner Form habhaft zu werden. Es findet sich keine fokussierte Abhandlung aus Spinozas eigener Feder, in der schon alles wesentliche über das Konzept der immanenten Kausalität enthalten wäre. In mühsamer Kleinarbeit müssen stattdessen aus allen Teilen von Spinozas Werk, das in großen Teilen immer zuerst auf Latein, und nur sekundär in niederländischer Sprache vorlag, mit nahezu detektivischem Feinsinn Fragmente zusammengepflückt werden. Stets sind alle möglichen und unmöglichen politischen, anthropologischen und theologischen Fragmente miteinander in einer Weise verknüpft, die eine geordnete Rezeption erheblich erschweren. Es liegt in der Natur der Sache, dass die thematische Orientierung dabei zu einem recht hohen Grad in der Hand der Autoren liegt. Der Streit um Spinoza sollte jedenfalls nicht darum geführt werden, wer das originale Material am orthodoxesten reproduziert, sondern wessen Konstrukt am sinnigsten auf gegenwärtige Probleme antwortet. Diefenbach setzt für ihre Erzählung jedenfalls Spinozas Theorie des Conatus ins Zentrum, von dem aus alle weiteren Fragmente ihren Platz zugewiesen bekommen.
Zwei Grundlinien des Conatusprinzips
Was ist überhaupt ein Conatus? »Conatus« ist eine zunächst antiquiert anmutende philosophische Bezeichnung für eine nicht näher bestimmte innere Essenz eines beliebigen physischen oder geistigen Gegenstandes. Er bezeichnet einen vermuteten, natürlichen und inneren Drang, einen Trieb oder ein Streben hin zu einem bestimmten Zustand. Ein Stück Holz hätte den »Conatus«, im Wasser oben zu treiben, sprich sowohl die physikalische Möglichkeit als auch den „Willen“, nach oben zu schweben. Physikalische Materie hätte dementsprechend den »Conatus«, sich in Richtung eines Gravitationszentrums zu bewegen. Üblicherweise ist das „Ziel“ des Conatus, also der zu erreichende Zustand, positiv besetzt, also etwas „das Leben“, „die Wahrhaftigkeit“, „die Fähigkeit“ oder dergleichen.
Was für heutige Ohren im Bereich des physikalischen Welt als hoffnungslos archaische Ausdrucksweise erscheint, soll in der politischen Welt doch eine gewisse Gültigkeit haben. Die Physik hat zwar moderne Begriffe wie Trägheit und Impuls geschaffen, mit denen sie jeden Bezug auf einen Willen oder eine göttliche Kraft innerhalb der Materie verabschiedete. In der Gesellschaftstheorie kann man aber noch nicht ohne weiteres von solchen Erfolgen sprechen, zumindest nicht solange ihr Mainstream nicht müde wird, seine Ratlosigkeit angesichts der angeblich so sehr aus den Fugen geratenen Welt zu betonen. Spinoza jedenfalls baute den sicherlich unglücklichen gewählten Grundbegriff des Conatus trotz allem zu einer umfassenden politischen Lehre aus. Heute ist diese Lehre leider nicht mehr ohne weiteres von seinem Beitrag zur immanenten Kausalität zu trennen, der uns hier eigentlich interessiert. Leider haben auch etwa die Beiträge von Antonio Negri oder Étienne Balibar nicht dazu Beigetragen diese Verwirrung aufzulösen, sondern haben stattdessen selber für eine noch größere Verbreitung der Conatusbegriffs gesorgt. Dafür gab es auch eine einfache konjunkturelle Erklärung gibt: Spinoza bezog seine Theorie auf die Fähigkeiten des Volks oder der Masse, wenn es um das Potential zur demokratischen Umwälzung der Gesellschaft ging. Nichts lag also näher, als die Probleme von Marxismus, die ja wirklich an nicht-triviale Grenzen gestoßen waren, zu „lösen“, indem man die Ideen von Klasse und Revolution durch die demokratische Transformation des Volkes ersetzt.
Aus heutiger Sicht fällt die Bilanz postoperaistischer und postmarxistischer Theorie zwar je nach Sichtweise bisweilen dürftig aus. Die radikalen Demokratietheorien etwa, die eng mit Balibar und der Idee eines Marxismus nach Marx verknüpft sind, haben in den letzten Jahren empfindliche politische Niederlagen eingefahren. Und auch die großen Aufschläge von Antonio Negri blieben in vieler Hinsicht folgenlos: Sein Blick auf das Empire konnte die Lücke nicht füllen, die nach dem Niedergang der klassischen Imperialismustheorien blieb. Seine Vorstellung von multitude (=Negris moderne Wendung von Spinozas Masse) konnte bisher noch nicht so recht auf wirkliche Bewegungen verweisen.
Dabei ist der Grundgedanke des politischen Conatusprinzips recht einfach: Wenn die Inspirationskraft des Begriffs der Klasse erschöpft ist, muss der Begriff der Menge oder multitude an seine Stelle treten. Gleichzeitig muss nach einer neuen theoretischen Begründung gesucht werden, wie und warum die multitude wirksam werden kann. Die Macht der Klasse (begründet im Streik, in ihrer einheitlichen Sozialstruktur, in ihrem intuitiven Verständnis für das allgemeine Unrecht etc.) war nicht schwer zu plausibilisieren, warum aber gerade eine zusammengewürfelte Masse noch bessere Eigenschaften haben sollte, musste erstmal dargestellt werden. Diefenbach zeichnet nun genau diese Debatten über eine moderne, sozialwissenschaftliche Wiederaneignung des Conatusprinzips nach. Der Natur dieses Begriffs entsprechend bleiben diese Debatten aber dunkel und schwer nachvollziehbar. Zwei Grundlinien lassen sich jedoch darin ausmachen.
Zum einen der Leitsatz Spinozas, jeder Staat verdiene in etwa so viel Respekt, wie er es seinen Bürger*innen ermöglicht, ihr volles Potential auszuleben: „tantum juris quantum potentiae“ (51). Hier wird deutlich, wie der philosophische Gedanke eines natürlichen inneren Lebensdrangs eines Menschen oder einer Volksmasse bei Spinoza in eine Staatstheorie gegossen wird. Spinoza würdigt hier das Staatsprinzip Demokratie, jedoch auf eine ganz andere Art, als es zu Zeiten der dominanten Vertragstheorien gedacht wurde: Die Legitimität der Demokratie bestehe nicht in ihrer überlegenen rechtlichen Fundierung im Rahmen freier vertraglicher Zusammenschlüsse, sondern in der Fähigkeit, ständig den sozusagen natürlichen Lebensimpuls aller Menschen, also den Conatus der Masse zu Geltung zu bringen.
Andererseits ist Demokratie nach Spinoza eben nicht nur legitim, sondern auch mächtig: Der natürliche Drang zum demokratischen Leben existiert nicht nur so zum Spaß, sondern stellt einen neuen, mächtigen Motor der Geschichte (mächtiger als der Klassenkampf) und des sozialen Wandels dar – also genau das, wonach der frühe Postmarxismus gesucht hatte. Die potentia multitudinis quae una veluti mente ducitur, also „die Macht der wie von einem Geist geleiteten Menge“ (311), besteht in ihrer Fähigkeit, durch die vielen tausenden kleinen Austauschprozesse, die in einer aktiven Menschenmasse eben geschehen, „eine Intelligenz von unten zu induzieren, die sich egalitär zu instituieren vermag“ (325). Die angestrebte „Befreiung ist nicht auf eine subjektive Tathandlung oder einen kollektiven Willen zurückführbar“ (339); stattdessen müsse das nationale Genie des „Massenimaginären“ (328) für eine befreiendes Handeln in Gang gesetzt werden.
Was ist: Spekulativer Materialismus?
Tatsächlich ist uns eine solche Denkweise heute nicht in erster Linie durch Spinoza, sondern durch Michel Foucault überliefert. Ihre Gemeinsamkeit kann am besten durch die sie verbindende Zurückweisung des Subjekts im Sinne von René Descartes dargestellt werden: „Wo das cogito die ganze Welt reduziert und wegnimmt, um sich in seiner reinen Intellektualität zu erfahren, entsteht das Denken bei Spinoza aus der Wahrnehmung körperlicher Austausch- und Affizierungsprozesse“ (339).
Die Differenz besteht also im Verhältnis von Subjekt und Materialität: Während das Subjekt im klassischen Sinne der europäischen Aufklärung nach Descartes sich gerade durch die Trennung von der Materie konstituiert, und sich insofern zum Verstand erklärt, als dass es nur seinem eigenen, wohlüberlegten Urteil traut und darauf vertraut, dass – einen guten Willen zur Erkenntnis vorausgesetzt (sprich: nicht schummeln!) – keine externe Kraft in den unbestechlichen Verstand intervieren kann, sich keine ideelle Wahrheit sich lange vor der Vernunft im Gewimmel des Materiellen verstecken kann, und sich erst so auch ein materialistischer Zugang zur Welt eröffnet, die ja nicht einfach „tote“ Materie ist, sondern aus dynamischen Verhältnissen besteht, ist es im Spekulativen Materialismus tendenziell umgekehrt: Nicht das Subjekt, sondern das Verhältnis Subjekt-Materie an sich ist das primäre, das Subjekt entsteht erst aus der subjektiv-objektiven Ursuppe heraus und bleibt stets seiner Geworfenheit in die Verhältnisse verhaftet, seine Unabhängigkeit sei imaginär und irreführend. Diese Umdrehung ist, nebenbei gesagt, auch überhaupt stilbildend im Übergang von den „klassischen“ zu den „neuen“ Materialismen, die insofern auf völlig entgegengesetzten Fundamenten stehen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass auch die entsprechenden Auffassungen von Ideologie und Wahrheit genau entgegengesetzt sind. Wir stoßen auf…
“… Elemente einer Ideologietheorie, in der in Umkehrung zu Marx’ Vorstellung nicht die Ideen der herrschenden Klasse als wirklichkeitsverschleiernde Zeichen, sondern die Imaginationen der Beherrschten als wirklichkeitserzeugende Praktiken gelten. Die Individuen arbeiten ihre Beziehungen … in der Produktion gemeinsamer Wahrnehmungsbilder … aus, in denen kodifiziert ist, was … als Gleichheit und Glück, Gerechtigkeit und Freiheit … gilt. Dieser Prozess ist keine Widerspiegelung von Realität. … Er induziert kein falsches Bewusstsein, sondern er produziert … den Schauplatz, auf dem die Individuen die kollektiven Vorstellungen von ihren Lebensformen … immer wieder erneuern.” (327)
Der Determinationsfaktor der Verhältnisse auf das Bewusstsein ist damit weitgehend neutralisiert, oder eben besser gesagt: umgedreht. Die These dieses Modells muss daher ernst genommen werden, seine Vor- und Nachteile abgewogen. Diefenbach geht etwa ab der Mitte des Bandes genau diesen Weg, die These des spekulative Materialismus in all ihren bisherigen Ausprägungen nachzuvollziehen. In Anlehnung an Pierre Machereys Studie Hegel oder Spinoza oder auch in Anlehnung an Diefenbachs eigene Anordnung „Spinoza oder Descartes“ (408) geht es für die politische Theorie heute dabei letztendlich um die Frage Marx oder Spinoza. Wie immer bei solchen Fragen steht aber nicht der Zusammenprall zweier akademischer Kulturen als Selbstzweck im Vordergrund, sondern das abwägende Suchen nach geeigneten Positionen für die anstehenden Herausforderungen.
Die Neubewertung der Rationalismusdebatte
Um es vorwegzunehmen: Diefenbach wird sich am Ende ihres Bandes weitgehend vorbehaltlos auf die Seite der Spekulativen schlagen; in ihrer Kritik von Descartes bis Lenin bleibt letztendlich kein gutes Haar an den Theorien politischer Determination. In diesem Rahmen kommt Diefenbach dennoch zu einer überraschenden Analyse des alten Streits innerhalb der französischen Philosophie, der als eine Parallele zu den deutschen Rationalismusstreits begriffen werden kann. Vollzog sich in Deutschland der Streit um Rationalismus und Materialismus größtenteils in Bahnen von Geschichtsphilosophie und Soziologie[2], fand die vergleichbare Auseinandersetzung in Frankreich erst ab den 1950er Jahren statt und konzentrierte sich auf philosophische und anthropologische Themenbereiche, was einen nicht weniger als 30 Jahre anhaltenden Streit zwischen phänomenologischen und strukturalistischen Positionen (427) nach sich zog.
Die hauptsächlichen Kontrahenten hießen Ferdinand Alquié und Martial Gueroult. Alquié interpretierte Descartes aus einer existentialistischen Perspektive. Je stärker Descartes im Verlauf seines Lebens auf die Kraft der reinen Vernunft gesetzte habe, desto deutlicher wäre ihm die prinzipielle Unmöglichkeit eines geschlossenen vernünftigen Denkens entgegengetreten. In diesem Mangel, besser gesagt im Überschuss an der „existenziellen Erfahrung menschlicher Unvollständigkeit vis à vis Gottes Unendlichkeit“ (409), sei Descartes’ eigentliche Pointe zu sehen. Die Philosophie der Erfahrung, des Sinns oder des Subjekts sei deswegen ein notwendiges, nicht reduzierbares Korrelat zur Vernunft. Die (politische/soziale/philosophische) Welt sei eben nicht allein rational zu erfassen. Dagegen stand Gueroult mit seiner konventionellen und rationalistischen Descartes-Lesart.
Doch in der französischen Konstellation kommt es, aufbauend auf dieser Situation, zu einer bedeutungsschweren Neubewertung des Rationalismusstreits, die den Diskurs bis heute prägt. Denn Descartes’ aufklärerische Positionen hatten ja tatsächlich große Begründungsprobleme – wenn es auch nicht diejenigen waren, die Alquié im Auge hatte. Deutlich wird das nicht zuletzt an den politischen Positionen des historischen Descartes, die, wie uns Diefenbach erinnert, aus heutiger Sicht durchaus ambivalent waren, und sich auch in die katholische Gegenreformation einreihen lassen.
Je mehr Gueroult sich in den Streit um Descartes’ Rationalismus verwickeln ließ, desto tiefer verstrickte er sich in genau diese Lücken und Schwierigkeiten – und je mehr Alquié phänomenologisch und hermeneutisch über den existenziellen Überschuss des Subjekts ins göttliche spekulierte, desto mehr stand er in mancher Hinsicht als der viel rationalere Überprüfer der Vernunft und ihrer eigenen Grenzen da. Der Hermeneutiker Alquié – schreibt Macherey – liest „Descartes mit den Augen Kants“, während Gueroult – folgert Diefenbach – ihn „durch die Augen Spinozas“ (420) liest. Durch diese Umdrehung geht in Frankreich gerade Spinoza als der Rationalist in den Kanon ein, während Descartes fortan zu den Bewusstseinsmetaphysikern gezählt wird! Hier liegt also der Ursprung für das moderne Missverständnis, ausgerechnet das Umstoßen des Cartesianismus würde die Menschen wieder für den Kampf gegen die entsubjektivierende Vergesellschaftung des Neoliberalismus rüsten, während der autoritäre Plattform-Kapitalismus sich in der Realität ja nichts sehnlicher wünscht, als gerade die völlige Verflüssigung des autonomen Subjekts. Der Schlussstein hinter der Debatte, Alquiés 1981 erschienenes Buch, hieß dann auch programmatisch: Le rationalisme de Spinoza. „Spinoza gilt [damit] … als kohärenter Systematiker eines absoluten Rationalismus …, der … das Okkulte und Unbegreifliche aus dem Denken des Unendlichen vertrieben hat“ (425).
Die Ausgangspositionen des Streits hatten sich damit um 180 Grad gedreht, die Seite der Aufklärungskritiker war erheblich gestärkt aus der Debatte hervorgegangen: Sartre, Merlau-Ponty, Lacan, Deleuze (seinerseits Schüler Alquiés) und natürlich Foucault sollten erheblichen Einfluss bekommen, während die Arbeiten von Canguilhem, Cavaillès, Koyré und Bachelard fortan eine geringere Rolle spielten.
Marx oder Spinoza?
Die letzte wirkmächtige Inkarnation dieses bemerkenswerten findet sich in Slavoj Žižeks „Wiederaneignung“ von Lenin. Žižek ist nämlich der Meinung, dass die moderne politische Konstellation am besten mit Lenin begriffen werden kann, weil dieser angeblich den prinzipiell kontingenten Charakter der Politik am besten erkannt habe (504): Die Revolution sei zu machen oder wenigstens zu denken, aber nicht abzuwarten.
Žižek gewinnt diese Position, soweit Diefenbachs Rekonstruktion, aus der Tradition eines „lacanianischen Cartesianismus“ (498). Wie dieser allerdings genau aussehen soll, wurde doch gerade von Diefenbach selbst Lacan in eine anti-cartesianische Traditionslinie eingeordnet, bleibt offen. Žižeks Lesart Lenins, die auf eine Apologie der Schwächen der bolschewistischen Theorie herausläuft, basiere auf einer Hegelianischen und Jakobinischen Tradition: Die Revolution darf nicht auf halbem Wege stecken bleiben, deswegen wird die revolutionäre, fast dezisionistische Gewalt zum Mittel der Wahl, um den Prozess auch gegen Bedenken am Laufen zu halten. (514).
Diefenbachs Kritik trifft Žižek insofern, als das solche kritische Aneignungen von Lenin heute zwar weit verbreitet sind, sich im Wesentlichen aber meistens dadurch auszeichnen, von den inhaltlichen Arbeiten des „nachlesbaren Lenin“ so weit zu abstrahieren, dass am Ende keine wahrheitsfähige Aussage über den Zusammenhang von ökonomischer und politischer Sphäre übrig bleibt, die doch zweifellos zu Lenins Kernthemen gehörte. Kaum einer hat die eigentliche Aufgabe der politischen Ökonomie, nämlich die geordnete Ableitung von politischen Programmen aus ökonomischen Untersuchungen, so entschieden vorangetrieben wie Lenin. Die vielen Wiederaneignungen beginnen aber niemals dort, sondern stets bei differenziallogischen und radikaldemokratischen Spezialproblemen, die mit der ursprünglichen Fragestellung der Determinationszusammenhänge überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und so appropriiert dann auch Diefenbach Lenin und verklärt ihn zu einem Denker der „antideterministischen Position“ (503).
Der ganze Clou der Debatte liegt dann am Ende darin, eine spinozistisch aufgeladene Fiktion der Demokratie der Massen gegen den dämonisierten Leninismus in Stellung zu bringen, der seine einstige Erkenntnis des „Primats des Politischen“ verschenkt habe. Die zunehmende Ausschaltung der Rätestrukturen sei der Sündenfall der Bolschewiki, weil so „die Massen, die die Revolution getragen haben“ (522), nach und nach aus dem Prozess ausgeschlossen wurden. Nun kann man das aber natürlich nur anprangern, wenn im Rahmen einer romantischen Erzählung von der tugendhaften Masse davon ausgegangen wird, dass diese ganz naturwüchsig und von selbst eine progressiveren Standpunkt entwickelt, als die Partei ihn je haben könnte – also ganz genau entsprechend dem Konzept des Conatus, in dem der Standpunkt der Masse eine natürliche innere Tendenz zum Progressiven hat. Dass aber historisch natürlich die Kräfteverhältnisse oft gerade andersherum stehen, wird als Bezugsproblem damit elegant aus dem Weg geschafft.
Die Frage wie Revolution zu machen sei, wird dadurch pazifiziert und in einen für die bürgerliche Ordnung akzeptablen Rahmen transformiert. Zu machen sei sie durch die spontane Mehrheitsbildung des Volks: „Die Konstitution von Massenintellektualität … kann nicht das Ergebnis äußerer Aufklärung sein, denn niemand kann zur Demokratie erzogen werden. Sie kann auf keiner Tugend der multitudo basieren …. Sie kann nur das Resultat ihrer eigenen praktischen Selbstinstituierung und Selbstbestätigung sein“ (579 f.). Offenbar kann die Philosophie mit ihren eigenen Mitteln diesen voluntaristischen Horizont nicht überwinden, der ja nichts anderes ist als der Leidensdruck der dreiteiligen Depression aus verbaler Radikalität, faktischer Machtlosigkeit und dem tiefen Bedürfnis nach plötzlicher Erlösung durch spontaneistische Auflehnung, der die Erscheinung gegenwärtiger westlicher Widerstandsbewegungen so nachhaltig prägt.